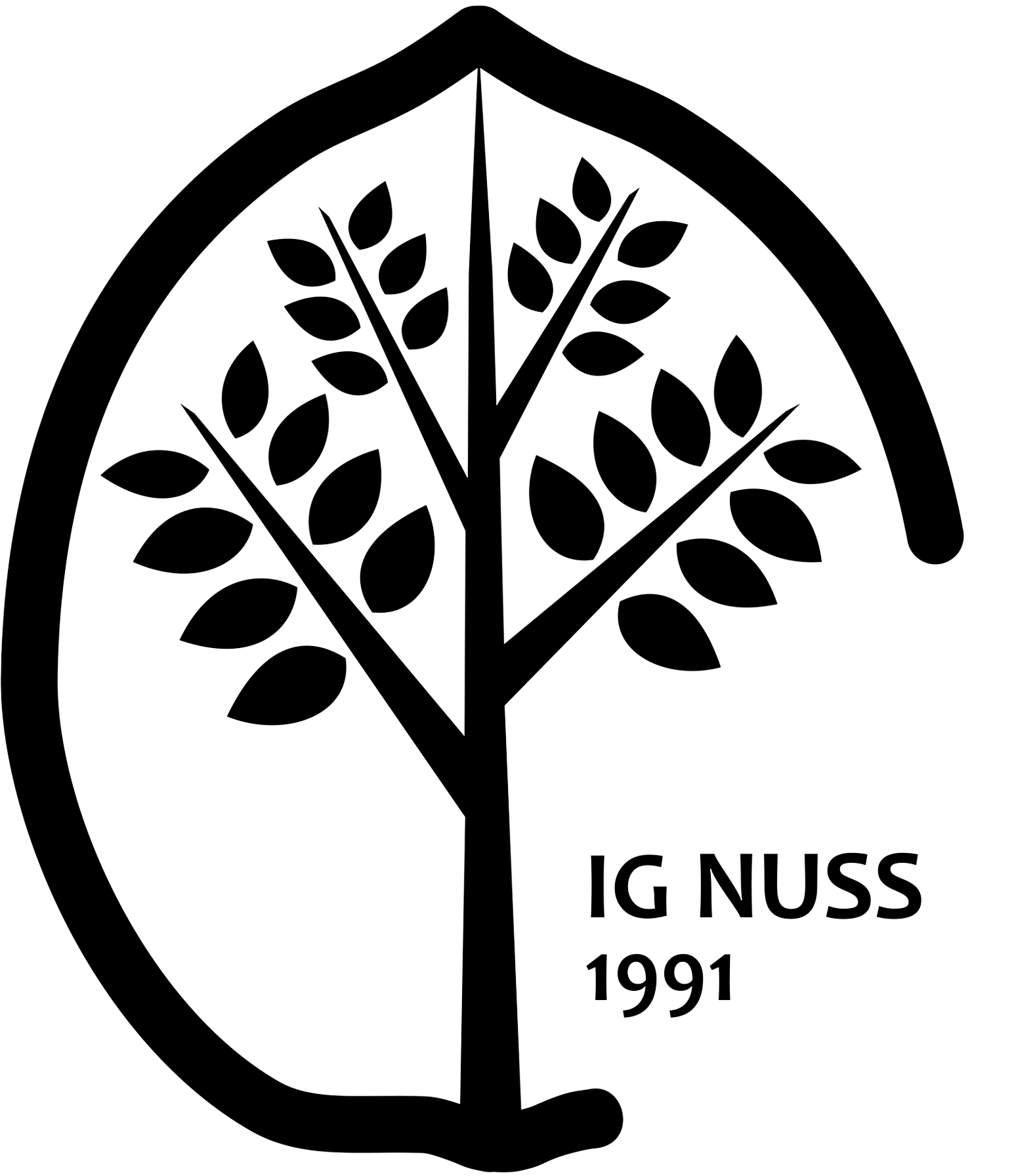Bildlich war dies am ehesten durch zwei Punkte zu erkennen: Die Vorträge fanden in einem gut ausgestatteten Hörsaal in Witzenhausen statt, zu dem ergänzend auch Räume für die Workshop-Arbeit genutzt werden konnten. Und: Mit mehr als 70 Teilnehmenden dürfte es das bislang größte Frühjahrstreffen der Walnussbauern innerhalb der IG Nuss gewesen sein. Gut die Hälfte der Besucher kamen aus der Forschung und dem Bereich Agroforst.
NuWiPi-Projekt soll den Wissentstransfer fördern
Entsprechend gemischt war Tagungsprogramm. Birge Wolf und Thorsten Michaelis von der Uni Kassel erläuterten den NuWiPi-Ansatz, der den Wissenstransfer zu diesen Themen sowohl aus der Praxis als auch aus der Wissenschaft zusammengetragen und in verschiedenen Formaten potenziellen Anbauern angeboten werden soll. Dazu gehört, das Interesse bei weiteren Landwirten zu wecken, um dann Informationen und Vernetzung mit Experten und Praktikern anbieten zu können.
Zu diesen Experten gehören unter anderem die IG Nuss, aber auch Agroforst-Forscher, wie sie auch an der Uni Kassel tätig sind. Der Ansatz über Agroforst-Systeme will Ackerbau mit Gehölzen kombinieren, um beispielsweise Erosion und Austrocknung des Bodens zu begegnen.
Über die Möglichkeiten des Einsatzes von Walnussbäumen in Agrofforstsystemen referierte Christoph Meixner. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Triebwerk, einer UG, die sich der regenerativen Landwirtschaft verschrieben hat und von Nordhessen aus europaweit tätig ist. Walnussbäume stellen eine trockenrestistente Agroforst-Variante dar, deren Früchte ein weiteres Standbein für landwirtschaftliche Betrieb sein können. Allerdings sind es auch Früchte mit Besonderheiten.
Wissen zur Ernte und Trocknung von Walnüssen fehlt auch bei privaten Verkäufern
Was ist zu beachten bei Anlagengestaltung, Sortenauswahl und auf der Anlage selbst, aber auch in den weiteren Arbeitsschritten nach der Ernte, schilderte Vivian Böllersen in einem Impulsvortrag zur Qualitätssicherung. Die Diskussion um bestimmte Schadbilder und die Lagerung der Nüsse führte aber auch zu einem Kern-Problem, das es bei fast alle ankaufenden Betriebe haben: Das Wissen vieler Privatleute zur Ernte und Trocknung von Walnüssen ist lückenhaft. Auch dort müsse eine Informationsplattform ansetzen.
Ansatz zu Bonitierung: Welche Walnusssorten sind für welche Regionen die besten?
Die Klammer zwischen Wissenschaft und Praxis setzte ein Vortrag von Matthias Moos, bei dem es letztlich um nicht weniger als die Frage ging: Welche Walnusssorten sind die besten – vorzugsweise für den Anbau in deutschen Regionen? Er stellte den Ansatz für eine Bonitierung nach Hans-Sepp Walker vor. Insbesondere angesichts der zunehmenden Gefahr durch Spätfröste könnte so herausgefunden werden, welche Sorten für spätfrostgefährdete Gebiete am ehesten geeignet sind.
Bei der praktischen Anwendung zur Früchte- Bewertung tauchten in den Gruppen allerdings noch Fragen auf, die bei der Verfeinerung des Konzepts berücksichtigt werden sollen. Am Ende könnten so gewonnene Walnuss-Einschätzungen nicht nur Einsteigern eine wertvolle Hilfe zur Sortenauswahl sein.
Was hilft gegen die Walnussfruchtfliege? Viele Ansätze erweisen sich nicht unbedingt praxistauglich
Nicht nur Neueinsteiger sprach der Vortrag von Jürgen Stirm an, der selbst Walnüsse anbaut, verarbeitet und Beratung für Einsteiger anbietet – und sich entsprechend intensiv auch mit Schädlings- und Krankheitsproblemen befasst.
Besonders im Fokus steht dabei die Walnussfruchtfliege, der sich Tobias Storch von der Pflanzenschutzberatung der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen in seinem Vortrag widmete. Storch sorgte für Ernüchterung: Keine der bisher empfohlenen Vorgehensweisen hilft wirklich. Gelbfallen seien höchstens ein Indikator für den Flug von Walnussfruchtfliegen und könnten den Zeitpunkt zum Handeln anzeigen. Kursierende Tipps wie das Abdecken des Bodens mit engmaschigen Netzen oder Folien, eine Hühnerhaltung sowie das Einsammeln und Vernichten von Nüssen sind bei einer größeren Anbaufläche kaum machbar. Die Effekte von Nematoden seien bisher nicht nachgewiesen, zudem passe sich die Fliege dem Sortenspektrum an.
Fazit: Im ökologischen Anbau gibt es bislang keine direkten Bekämpfungsmaßnahmen, kann nur eine auf den jeweiligen Betrieb abgestimmte Kombination von Maßnahmen etwas bringen.
Andere Mittel stehen in Deutschland kaum zur Verfügung. Der in Deutschland mögliche zweimalige Einsatz von Mospilan SG sei durch den verzögerten Schlupf der Walnussfruchtfliege nur eingeschränkt wirksam. Dazu komme, dass eine Einsatzhöhe von mehr als drei Metern Probleme beim zielgenauen Einsatz bereite.
Der Einsatz von Spinosat sowie fehlende Daten waren auch Thema in einer der drei Workshopgruppen des Treffens. Es stelle sich aber auch die Frage, ob der Einsatz von solchen Mitteln von den Verbänden überhaupt gewollt ist, so Storch.
Zum Vormerken: Der Termin für das Frühjahrstreffen 2026 der Walnussbauern steht bereits fest
Möglicherweise ist die Positionierung der Verbände zur Frage von Bekämpfungsmitteln ein Thema für das nächste Frühjahrstreffen. Das 10. Frühjahrstreffen der IG Nuss findet am 21. März 2026 statt. Autor: Jürgen Scholz